Wir bieten zum kostenlosen Download an.
- drei honorarfreie Fotos
- Die Beantwortung rHäufig gestellte Frage
- Hintergrundgeschichten (zunächst über die ZDF-Serie “Anwalt Abel”, wird erweitert)
HONORARFREIE FOTOS ZUM DOWNLOAD:
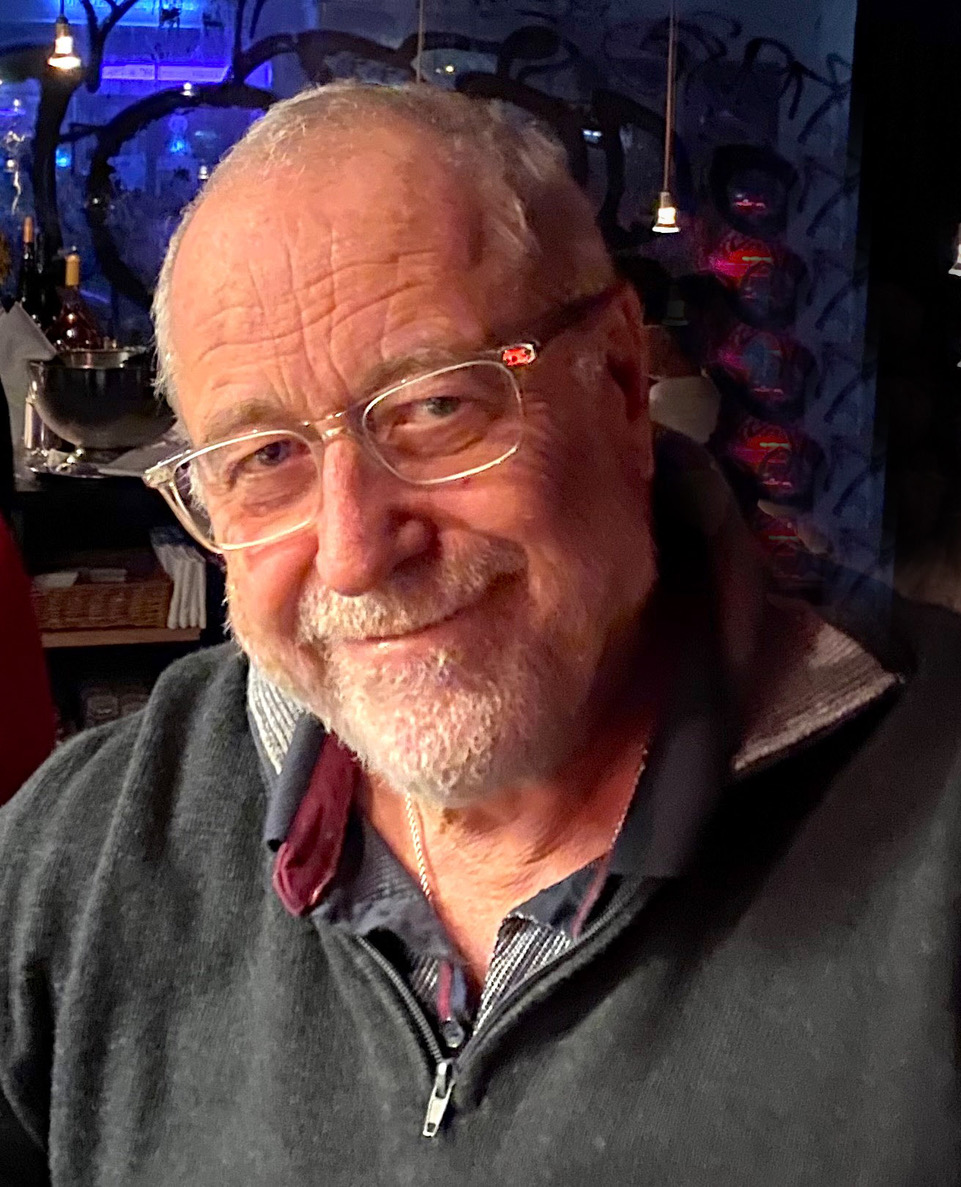


HÄUFIGE FRAGEN UND DIE DAZU PASSENDEN ANTWORTEN:
Wie wurden Sie von Anwalt zum Autor?
Ich liebte Krimis und versuchte schon früh, selbst zu schreiben. Die erste konkrete Inspiration bekam ich als Referendar bei der Kripo Tübingen, als mein Ausbilder abends eine PanAm-Tasche vom Schrank holte und mich einen Blick hineinwerfen ließ. Ich sah Teile eines Skeletts, alles genau asserviert. Bei einem Bier erzählte er die Geschichte eines mysteriösen Skelettfundes bei Bebenhausen, er sprach über die langwierige Identifikation, bis es gelang, den Fund einer seit Jahren vermissten Krankenschwester zuzuordnen, die in der denkwürdigen Nacht des legendären Weltmeisterschaftskampfes Muhammad Ali gegen Joe Frazier in Kinshasa am 30. Oktober 1974 spurlos verschwunden war. Bis heute ist noch nicht geklärt, ob die Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen war, geschweige denn die näheren Umstände ihres Todes. Ich dachte mir dazu eine Geschichte aus, in deren Verlauf ich mich heillos im Plot verhedderte. Ich brach ab, hatte aber definitiv Blut geleckt.
Wie ging es weiter mit dem Schreiben?
Lesen Sie dazu weiter unten das Kapitel „Wie Abel auf die Welt kam“.
Ist Ihr Studium und Ihre Praxis als Anwalt beim Schreiben hinderlich?
Im Gegenteil, die Werkezuge sind dieselben. Das Wort. Als Anwalt lernt man sehr genau damit umzugehen. Ein falsches Wort kann im Extremfall Schicksale entscheiden. Der Autor gestaltet mit den wenigen Zeichen, die unsere Schrift kennt, ganze Welten in der Phantasie der Leser, Zuhörerinnen und beim Publikum. Medium sind immer präzise gewählte Wörter.
Gibt es noch Reminiszenzen an ihre Anwaltspraxis?
Ich bin stolz darauf, dass ich tausenden Ärzte, Zahnärzte, Architekten, Psychologen und andere Opfer des unsinnigen Numerus clausus ins Studium helfen konnte. Nicht selten bekomme ich Mails oder Anrufe von ehemaligen Klienten, die meinen Namen auf einem Filmabspann gesehen haben und mir sagen, wie wichtig es für sie war, ihren Wunschberuf ergreifen zu können. Viele sind erfolgreich geworden. Ein Arzt rief mich vor zwei Jahren an und sagte, er schulde mir noch eine Flasche Champagner. Bevor er seine Praxis schließe, wolle er die Schuld loswerden. Wir trafen uns in einem Kaffee am Gendarmenmarkt, und mein ehemaliger Klient erzählte mir von seiner gut gehenden Praxis, nun habe er genug verdient und wolle etwas zurückgeben. Er ging zu „Ärzte ohne Grenzen“. Chapeau!
Wie kommen Sie zu Ihren Stoffideen?
Das ist völlig unterschiedlich, vieles fällt mir ein, beim Lesen, beim Sport, in schlaflosen Nächten. Früher kamen oft Aufträge direkt von den Sendern. Heute haben weitgehend die Produzenten die Rolle der Stoffentwickler zusammen mit den Autoren übernommen und gehen damit auch ins finanzielle Risiko – beide, Autor und Produzent. eigentlich ist das nicht fair, deswegen haben einige wenige Sender eigene Entwicklungsetats, die größte Finanzlast der Stoffentwicklung übernehmen die Drehbuchförderungen von Bund und einzelnen Ländern. Die Produzenten bieten dann die Ideen und Stoffe den Sendern und Finanziers an.
Warum sind Sie auch ins Produzentengeschäft eingestiegen?
Um besonders wichtige Projekte möglichst lang und intensiv zu begleiten zu können. Das verlangt einen langen Atem, viel Zeit und auch Cash. Und bei weitem nicht alle Projekte lassen sich trotz jahrelanger engagierter Arbeit realisieren. 2017 ist beispielsweise die Finanzierung der Verfilmung eines internationalen Bestseller-Krimis geplatzt. Wenn man allerdings einen Film so weit bringt, dass er realisiert werden kann, hat man praktisch immer verlässliche Partner gefunden, die nicht nur die Entwicklung und Finanzierung begleiten, sondern den Film auch herstellen. Bittere Erfahrungen gibt es allerdings bei der Partnerwahl auch – wie im richtigen Leben. Aber der wunderbare Moment, bei einer internationalen Premiere, beispielsweise im Wettbewerb der “Berlinale” auf der Bühne zu stehen ist nicht nur Lohn für jahrelange Arbeit – es ist einfach ein geiles Gefühl, das man nicht mit Geld kaufen kann.
HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU “ANWALT ABEL”
Wie Abel auf die Welt kam.
Eigentlich habe ich nie Autor werden wollen. Aber geschrieben habe ich schon früh. Das ganze artete dann nach der Pubertät in Liebesgedichte aus. Der Höhepunkt an Peinlichkeit war ein Zyklus „Elegien für ein Mädchen“, geschrieben für eine niedliche Schülerin des Nachbargymnasiums. Sie hatte einen guten Geschmack und zerriss mein Oeuvre in der Luft. Wir „gingen“ dennoch ein paar Monate zusammen. Ich dichtete heimlich weiter. Wechselte die Themen. Gedichten über Natur und Politik waren das Resultat.
Ein kleiner Verleger erhielt eines Tages völlig unvorbereitet von mir die Gedichte zugeschickt. Der Schock saß so tief, dass er mehr als ein halbes Jahr brauchte, bis er mir in einem langen Brief die Aussichtslosigkeit meines Ansinnens erklärte – ja Sie lesen richtig, damals gab es Verleger, die Manuskripte nicht mit dem Hinweis zurückschickten, das Werk passe nicht ins Programm. Am Schluss des sehr ehrlich gehaltenen Schreibens riet er mir, etwas Vernünftiges aus meinem Leben zu machen, bloß nicht Autor zu werden, mindestens aber eine schöpferische Pause einzulegen und vielleicht später mal wieder zur Feder zu greifen. Ich war derartig wütend, dass ich den Brief sofort zerriss. Schade. Soweit ich mich erinnere, war er wirklich sehr offen gehalten.
Ich schrieb fortan Aufsätze für die Schule und an der Uni Klausuren und eine Doktorarbeit, aber nie mehr Gedichte. Es gibt nur eine Ausnahme, nämlich ein gefaktes Poem, das ich Alkeksander Blok zuschreibe – in einem Drehbuch, in dem ich für die Story ein gefaketes und kein echtes Gedicht brauchte. Weil ich es nicht übers Herz bringe, meine Postpubertätsgedichte zu vernichten, habe ich sie sorgfältig versteckt.
Ich studierte zwischen 1968 und 1972. Da las man Marx und Markuse, Engels und Adorno, weniger lyrische Autoren. Erst nach dem Studium fing ich wieder an, heimlich Prosa zu schreiben; nun, sagen wir vielleicht besser Schreibübungen zu machen. Diesmal in einem anderen Genre.
Ich las gerne Krimis. Die Amerikaner, Schweden, natürlich Simenon. Bloß bei Agatha Christie habe ich es nie über die 30-Seiten-Marke gebracht. Aber in den anderen Krimis entdeckte ich einen direkten Zugang zu Menschen, Tätern, Opfern, bei den Schweden auf ihr soziales Umfeld und eine schnörkellose Sprache ohne die Gespreiztheit der langsam abgenutzten Avantgarde.
Und noch was. Krimis waren beim Establishment verpönt. Und wenn jemand sich gerne mit dem Establishment in die Haare bekam, egal auf welchem Gebiet, dann waren es die Ex-68er. Krimis waren damals in Deutschland geliebt und verpönt. Geliebt von einer zunehmenden Zahl von Lesern und Fernsehguckern, verpönt beim Bildungsbürgertum, besonders aber deren literarischem Sprachrohr, der Kritik. Marcel Reich-Ranicki ist immer noch stolz darauf, dass er Krimis nicht zur Kenntnis nimmt. Die einflussreichen Blätter sahen damals ganz einfach über das Genre hinweg. Gerade deswegen hat mich der Krimi interessiert. Die Bildungsbürger haben nämlich schon häufiger versehentlich über interessante Literatur hinweggesehen.
Und dann kommt noch hinzu, dass gute Krimis immer davon erzählen, wie Menschen eine ungeheuerliche Grenze überschreiten, nämlich das Tötungsverbot. Egal wie die Krimis geschrieben sind, ob als Wohodunit oder als Whydunit oder als Thriller. sie erzählen extreme Geschichten, mitten im Alltag, berichten über Menschen in extremen Situationen, die diese Geschichten durchmachen – bis zum tödlichen Ende. Deswegen finde ich, von Ausnahmen wie „Schweigen der Lämmer“ abgesehen, Storys über durchgeknallte Massenkiller langweilig. Meine Lieblingstäter sind die Bürger, die zu Brandstiftern werden.
Und dann muss man noch wissen, dass Krimis nicht nur ein düsteres und extremes Genre, sondern auch ein, milde gesagt, konservatives, früher hätte man sogar gesagt reaktionäres bilden. Denn am Anfang steht die ungeheuerliche Gewalttat, der Mord, die Welt gerät in Unordnung, die Staatsgewalt tritt sodann, meist in Gestalt eines Polizisten, in Erscheinung, ermittelt clever und manchmal schrullig, Und am Schluss wird der Fall gelöst. Die Ordnung ist wiederhergestellt. Weil das im richtigen Leben nicht so oft passiert, ist der Leser oder die Leserin zufrieden, schließt das Buch und legt sich beruhigt schlafen. Insoweit haben Krimis am Ende auch einen psychologischen Verdrängungseffekt.
Also Krimi. Ich begann mit Kurzgeschichten. Trainingsrunden. Nie veröffentlicht.
Inzwischen gab es den „NDK“, den „Neuen Deutschen Kriminalroman“. Deutsche Krimis spielten plötzlich nicht mehr im nebligen London oder den Häuserschluchten von Manhattan, Das Genre war hierzulande angekommen. Und es erzählte deutsche Geschichten. Die Neuen wurden wegen ihrer sozialkritischen Sicht auf die Dinge von den einen gefeiert, von anderen wurden die Krimis als „soziale Sauce“ geschmäht. Ich persönlich mochte ganz besonders Autoren wie –ky, dessen Pseudonym damals noch geheimnisumwittert war, Friedhelm Werremeier, Michael Molsner oder Hans Jörg Martin. Unter den ganz Jungen war ein gewisser Felix Huby, der noch eine wichtige Rolle bei der Geburt von Abel spielen sollte.
Die Sprache dieser Autoren, ihre Themen, die Sicht auf die Dinge und die Geschichten gefielen mir und passten zu der Zeit und nach Deutschland. Sie spielten plötzlich nicht nur in München, sondern auch in anderen Städten, nahmen sich die Milieus realistisch vor. Ein Erfolgskonzept, wie der „Tatort“. Einige dieser Autoren prägten das wohl bislang erfolgreichste Krimi-Format im deutschen Fernsehen mit denselben Prinzipien: Realismus statt Kulisse, sozial und psychologisch stimmige Geschichten, spannende, oft unkonventionelle Erzählformen. Dieses neue Krimi-Klima inspirierte mich bei meiner Suche nach dem Stoff, aus dem ein erster längerer Text werden sollte. Dass ich es nach Gedichten mit Krimis probieren würde, war mir schon lange klar.
Als ich in Tübingen, wo ich studiert hatte, als Referendar mein Praktikum bei der Kripo absolvierte, nahm ein Kommissar von „Mord und Totschlag“ eines Abends ein PanAm-Bordtasche“ vom Schrank, um mir etwas zu zeigen. Er öffnete die Tasche und legte Knochen und Teile eines Schädels auf den Schreibtisch. Zunächst hatte man die bei der Abtei Bebenhausen gefundenen Reste für Tierknochen gehalten, dann für ein Kriegsopfer. Doch die Rechtsmediziner fanden nicht nur heraus, dass es sich um eine junge Frau handeln musste, die schon ein Kind geboren hatte. Die Mediziner konnte sogar den Todeszeitpunkt auf einige Jahre eingrenzen. Lange nach Kriegsende. Bei der Identifikation half dann ein BH-Verschluss weiter, den man beim Durchsieben der Erde am Fundort entdeckt hatte. Er gehörte zu einem Modell, das nur über einen kurzen Zeitraum im Handel war. Die Kripo fand schließlich heraus, es waren die Gebeine einer jungen Krankenschwester, die zurückgezogen in Tübingen lebte, ihr Kind zur Adoption freigegeben hatte. Sie war in einer denkwürdigen Nacht verschwunden. In der Nacht als der Weltmeisterschaftskampf zwischen Muhamad Ali, damals noch Cassius Clay und Joe Fazier 1974 in Kinshasa stattfand. Die Nacht eines Jahrhundertfights, an die sich damals viele Menschen erinnerten, denn der Kampf lief live im TV und hatte sehr viele Zuschauer. Indes, die Spur der jungen Frau verlor sich im Nichts. Bis heute ist noch nicht einmal geklärt, ob sie Opfer eines Verbrechens wurde oder eines natürlichen Todes gestorben war, was angesichts ihres Alters und Gesundheitszustandes eher unwahrscheinlich ist.
Nachdem mein Kommissar die Knochen wieder in der Tasche verstaut hatte, ging ich sehr nachdenklich heim. Ich hatte meinen ersten Stoff gefunden. Eine Geschichte, die auf Tatsachen basierte, inspiriert durch einen realen Fall. Nebenbei bemerkt, habe ich diese Methode der Stoffsuche immer wieder angewendet. Bei Büchern und Filme. Von „Der Hammermörder“ über „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ bis kürzlich zu „Sophie Scholl – die letzten Tage“.
Ich machte mich damals an die Arbeit, erfand einen Kommissar, dem ich den Namen Ott gab. Der Anfang lief gut. Ich kam schnell in die Geschichte rein. Aber in diesen Jahren hatte ich viel zu tun. Examensvorbereitungen für das Zweite, Arbeit beim Anwalt, weil von irgendetwas ja der Schornstein rauchen musste. Das Manuskript blieb immer wieder liegen. Je weiter ich schrieb, umso mehr verhakte ich mich in der Story. Ich hatte vorher nichts geplottet, nur geschrieben wie es mir gefiel. Das Ganze war damals ja nichts als ein Hobby. Und schließlich hatte ich mich in meinem Stoff derart verheddert, dass ich nicht mehr weiter kam. Ein Krimi kommt ohne Logik und Glaubwürdigkeit einfach nicht aus. Der Roman blieb ohne Titel und ohne Schluss. Kurzgeschichten mussten wieder herhalten.
Ich hatte meine Anwaltszulassung und wohnte schon in Stuttgart, als ich einen Herrn Hungerbühler vom SPIEGEL kennen lernte, weil ich als junger Anwalt skandalöse Fälle im Zusammenhang mit dem damals noch neuen Numerus clausus an den Unis auf dem Tisch hatte und mich darum bemühte, dem Magazin die Story schmackhaft zu machen. Tatsächlich schrieb Hungerbühler eine Geschichte fürs Blatt und meine Anwaltskarriere begann. Denn Zulassungsbeschränkungen waren damals rabiat, die Wartezeiten lang. Und als Anwalt konnte man eine Menge für die Bewerber tun. Bei den Gesprächen bekam ich mit, dass Hungerbühler unter dem Pseudonym Felix Huby einen Krimi bei Rowohlt veröffentlichen würde, in der legendären Schwarzen rororo-Reihe, herausgegeben von „Leichen Richard“ Flesch. „Atomkrieg in Weihersbronn“, auch eine Geschichte, die auf Fakten basierte. Bienzle debütierte. Mir gefiel das Buch sehr gut und ich war ungeheuer stolz, einen der Neuen Deutschen Krimiautoren zu kennen. Nicht nur das, wir wurden dicke Freunde.
Irgendwann gab ich Huby das Manuskript mit dem verhedderten Plot und ohne Schluss zu lesen. Und ich gebe zu, ich hatte feuchte Hände, als er mit mir darüber sprechen wollte. Seit dem ehrlichen Ablehnungsschreiben des Poesieverlegers hatte ich keinen meiner Texte je wieder jemandem gezeigt. Noch nicht mal meiner Frau. Huby sagte, der Text ist ganz okay, aber noch nicht richtig gut. Er analysierte genau die weichen Stellen. Ich hörte genau zu. Immerhin war er einer der besten Reporter beim SPIEGEL und hatte auf Anhieb sein Debut bei Rowohlt geschafft. Am Ende des Gesprächs schlug er mir vor, doch einfach neu anzufangen. Mit einer völlig neuen Geschichte – und mit einer neuen Figur. Das klang besser als der damalige Vorschlag de Poesieverlegers.
Huby erklärte mir, die Leute von Rowohlt suchen auch mal andere Krimihelden, nicht nur Polizisten. Ich dachte sofort an einen Anwalt als Hauptfigur. So eine Art deutschen Perry Mason. Oder vielleicht was ganz Eigenständiges? Huby fand die Idee gut. Und ich fing mal wieder neu an zu schreiben. Immer noch als Hobbyautor, diesmal aber mit dem heimlichen Wunsch, eines Tages das Manuskript gedruckt zu sehen, dessen erstes Blatt in der Maschine steckte.
Ich erinnere mich genau, es war an einem trüben, regnerischen Frühsommersonntag 1977. Nachmittags. Meine Frau war mit unserer Tochter Leo zu ihrer Mutter gefahren. Ich saß in Stuttgart in meiner Kanzlei bei offenem Fenster an der Schreibmaschine unserer Bürovorsteherin. Ich spannte ein weiße Blatt ein. Mir war klar, mein Held sollte ein Anwalt sein … oder besser einer werden. Wie wäre es, wenn der Mann eine Biografie bekäme, die sich im Laufe der Zeit verändert? Heute fällt mir auf, dass ich damals wohl schon darauf spekuliert haben muss, mehrere Texte mit diesem Helden zu schreiben, sonst hätte ich mir wohl kaum Gedanken über biografische Entwicklungen gemacht. Und ich hätte den noch Namenlosen gleich Anwalt sein lassen.
Ich entschied mich aber dafür, diesen Anwaltskollegen zunächst als verkrachten Studenten einzuführen. Und dazu noch mit einer völlig anderen Profession. Als Privatdetektiv, aber mit der heimlichen Perspektive, das er, wie ich selbst kurz zuvor, seine Examina ablegen und seine Anwaltszulassung beantragen würde.
Ich wusste noch nicht viel über diesen Mann. Was weiß man schon über Menschen, die gerade geboren werden? Genauso ist es bei literarischen Figuren. Geburt und dann Name, dann das Kennenlernen.
Aber der Name einer Romanfigur muss etwas aussagen, Rückschlüsse auf seinen Träger zulassen. Von Anfang an sah ich in dem Kollegen schon einen anderen Menschen, als ich selbst es bin. Über sich zu schreiben finde ich langweilig. Eher die Figur auch nach ein paar Wünschen und Träumen formen, die man so hat. Das könnte interessant werden. Der Mann könnte ein charmanter Leistungsverweigerer sein, einer fast ohne Ambitionen, nur mit einer Leidenschaft. Sie heißt Gerechtigkeit. Einer der stets leugnet, dass es Gerechtigkeit auf dieser Welt gibt – und der dann sofort richtig loslegt, wenn es ungerecht wird. Einer mit einer feinen Nase, einem feinen Gaumen. Und was wäre mit einer zweiten Leidenschaft? Beispielsweise für Frauen? Und wenn er was mit Frankreich zu tun hätte, einem Land, das ich sehr liebe? Okay Frankreich. Ein französischer Vorname vielleicht? Jean war erfunden. Nachname? Ich habe darüber lange gegrübelt, vor der Schreibmaschine sitzend, in das grüne, feuchte Laub der Bäume vor dem Fenster starrend. Dann kam ich auf Abel. Wie? Keine Ahnung. Der Name eines biblischen Mordopfers als Helden? Mit so einem Namen einen als Studenten, später als Anwalt auf Mördersuche schicken?! Natürlich hilft ein Name alleine nichts. Aber Abel könnte so etwas wie ein Programm für die Figur werden.
So wurde Jean Abel geboren. Irgendwann an einem trübwarmen Frühsommersonntag 1977. Ich hatte damals noch keine Ahnung wie weit und wie lange er mich durch mein Leben begleiten würde.
Wie Abel zum Film kam
Das war schon kurios! Eines Tages rief mich ein höflicher Herr vom damaligen Südwestfunk namens Dr. Dietrich Mack an und fragte, ob er mich mal treffen könne. Er würde gern mit mir über die Filmrechte an einem meiner Romane sprechen. „Notwehr“. Er hatte ein zerlesenes Exemplar des Taschenbuches von einem Anwaltskollegen von mir aus Braunschweig, den ich nicht kannte, zugeschickt bekommen mit der Bemerkung, anstelle des sonst verfilmten Mistes, solle Mack es doch mit diesem Krimi versuchen, erklärte er mir ernsthaft. Er habe gelesen und sei interessiert.
Wir verabredeten uns im damals schicksten Lokal Stuttgarts (Film muss schick sein, dachte ich damals noch naiv). Mack stellte sich vor, er war von den Bayreuther Festspielen, wo er Assistent von Wolfgang Wagner war, zum Sender gewechselt und dort als Redakteur für Musik und Fernsehfilme zuständig. Ein gestandener Mann, neugierig und offen für Neues. Diese damals nicht außergewöhnliche Biografie eines Redakteurs kann man kaum mit heutigen vergleichen, wo mancher Gesprächspartner nicht mehr als ein durch ein paar Drehbuchseminare gekröntes abgebrochenes Studium vorweisen kann. Statt Offenheit erlebt man deshalb bei diesen Gesprächspartnern unsicheres Festhalten am scheinbar Bewährten, statt Neugier ängstliches Zaudern.
Nur dass nicht der Eindruck entsteht, ich schiebe „pro Dome“; mit Mack habe ich Auseinandersetzungen bis an den Rande der persönlichen Belastbarkeit erlebt. Nur nebenbei: das gipfelte darin, dass ich Mack mit dem damaligen Regisseur und heutigen „Starproduzenten“ Nico Hofmann kurz vor den Dreharbeiten zu unserem gemeinsamen Film „Quarantäne“ bei mir zu Hause rauswarf, weil wir uns derartig in der Wolle hatten. Aber mit Niveau. Und ohne Macks Offenheit für Neues säße ich heute – wer weiß – immer noch in meiner Stuttgarter Anwaltskanzlei und hätte nie ein eigenes Drehbuch geschrieben. Denn Mack begann das Gespräch über die Filmrechte mit einer Klarstellung: „Falls wir uns einigen, suchen wir einen guten Drehbuchautor für das Projekt, denn einen Grundsatz haben wir aus leidvoller Erfahrung: Ein Autor dramatisiert niemals seinen eigenen Roman.“ Mein Freund Jean Abel hätte an dieser Stelle der Kellnerin „zahlen!“ zugerufen. Ich sagte: „Über Prinzipien kann man hervorragend streiten.“
Und wir stritten! Am Ende stand es auf der Kippe, ob „Notwehr“ überhaupt verfilmt würde oder nicht. Wir einigten uns. Ich war bereit, weitgehend auf eigenes Risiko eine erste Fassung des Drehbuchs zu schreiben – aber ich würde schreiben; kein anderer. Dann würde man sehen. Daumen nach oben oder nach unten?
Ich weiß heute noch nicht, wo ich damals neben meinem stressigen Anwaltsjob (ich klagte damals für abgelehnte Studienbewerber Studienplätze am Fließband ein, Medizin, Zahnmedizin, Architektur …) die Zeit und Konzentration hergenommen habe, das Drehbuch zu schreiben. Und woher den Mut?
Ich spürte nämlich ziemlich schnell die Angst des Romanautors, sein eigenes Werk selbst zu zerstören. Weil ich niemals Unterricht im Drehbuchsreiben genommen habe, sondern diese Kunst mit allen ihren handwerklichen Grundlagen Schritt für Schritt in der Praxis gelernt habe, war mir der Unterschied zwischen der epischen und dramatischen Schreibe nur theoretisch geläufig. Die praktischen Schwierigkeiten bei der Umsetzung eines Romans in ein Drehbuch habe ich erheblich unterschätzt. Das fängt schon damit an, dass man enorm kürzen muss. Sogar ein relativ kurzer Text wie „Notwehr“ würde ungekürzt zu einem Mehrteiler geraten. Monströs und langweilig. Denn Film ist Komprimierung auf das wirklich Wesentliche. Jede Szene, ja jede einzelne Einstellung muss aus sich selbst sprechen, wenn der Film etwas taugen soll. Die in der epischen Form so reizvollen Ausgestaltungen, Abschweifungen und Arabesken hindern dagegen den Fluss der Filmerzählung. „Kill Your down Babys“, soll David O. Selznick zu einem Autorenkollegen gesagt haben, der einen eigenen Roman dramatisierte. Leicht reden hatte er, der Selznick, aber er hatte auch Recht.
Aus der notwendigen Kürzung und Komprimierung kann man auch des verbreitete Urteil erklären, ein Film sei immer schlechter als der Roman, auf den er beruht. Das Urteil ist falsch. Man darf beides nicht miteinander vergleichen, denn Roman und Film sind völlig unterschiedliche Erzählformen für denselben Stoff. Jede hat ihre eigene Qualität. Es kommt ja auch niemand auf die Idee, Das Drama „Romeo und Julia“ mit der Oper „Roméo et Juliette“ von Grounod zu vergleichen, weil hier der formale Unterschied sofort ins Auge springt. Und dennoch, Film und Buch scheinen einander näher verwandt, so dass das Gefühl, das Buch sei qualitätsvoller, habe mehr Tiefe, jedem bekannt ist.
Ich kann es mir nur so erklären, dass das Buch mit seinen etwa 30 schwarzen Zeichen (die Satzzeichen einmal mitgerechnet) auf weißem Untergrund in geradezu mythischer Weise Phantasiewelten im Kopf des Lesenden entwickelt, während der Film mit seinen sprechenden Bildern diese Welten begrenzt, weil vorgibt, dafür aber Spannung und Emotionen intensiver erleben lässt, was aber vom Zuschauer nicht als eine Art eigene Nachschöpfung des Werkes empfunden wird, sondern als etwas von außen kommendes.
Aber ich verplaudere mich! Wie dem auch sei, wer meinen Roman mit unserem Film vergleicht, wird manche Buchszene schmerzlich vermissen. Ich auch. Ich will gar nicht damit beginnen, sie aufzuzählen.
Einen Teil der Gott sei Dank nur virtuellen „Babymorde“ hatte ich begangen und schickte ein Drehbuch nach Baden-Baden, dessen erste Fassung Gnade vor den Augen der Redaktion fand, allerdings noch viele inhaltliche und dramaturgische Fragen aufwarf.
Nur eine davon sei erwähnt: Wie knüpfe ich die beiden, lange parallel laufenden Handlungsstränge enger? Wie stelle ich einen zeitlich früheren Zusammenhang zwischen der Geschichte des kranken Gretchens und der Sorge ihrer Mutter und dem Kampf Abels für seinen Klienten Waldmüller um die Werkzeugmaschine her? Im Roman soll der Leser von außen her über den seinen Urlaub unterbrechenden Abel zunächst an das schwierige, letztlich aber doch lösbares Problem des Streits um die Maschine mit einem Insolvenzreifen Unternehmen an die menschliche Tragödie um Gretchen heran geführt werden. Dann kann Waldmüller verschwinden, er hat seine Schuldigkeit getan (in ihm hat sich auch ein gutes Stück weit Käthes Charakter gespiegelt) und wir haben Abel, dessen Kampfgeist und Taktik kennen gelernt. Nun sieht sich Jean einer viel größeren Herausforderung konfrontiert, dem Kampf um das Leben eines Kindes – zuletzt sogar mit dessen Mutter.
Im Film funktioniert das nicht. Seine Dramaturgie fordert, dass von Beginn an klar ist, wer die Hauptfigur ist und mit wem wir durch die Handlung geführt werden. Seine Haltung und seine Konflikte sind dramatisch und damit wichtig. Folglich musste Käthe sofort am Anfang ins Bild gesetzt werden, und der „Fall Waldmüller“ wird zurückgenommen und parallel zur Krankengeschichte erzählt. Er hat nach wie vor die Funktion, Käthe zu spiegeln und den kommerziellen Streitfall in Kontrast zu der Menschlichen Tragödie zu setzen. Lange haben wir an der Verzahnung beider Handlungsstränge gearbeitet – besonders intensiv mit dem Regisseur.
Heute ist es fast undenkbar, dass ein Anfänger in die Erwägungen mit einbezogen wird, welcher Regisseur sein erstes Buch drehen soll – damals eine Selbstverständlichkeit. Mack hatte verschiedene Vorschläge. Ich nur einen einzigen: Peter Schulze-Rohr. Ich hatte mir den Namen gemerkt, nachdem ich den Film „Hautnah“ gesehen hatte. Schulze-Rohr hatte ihn mit Armin Müller-Stahl in der Hauptrolle nach einem Buch von Norbert Ehry glänzend inszeniert. Zur Erinnerung: Müller-Stahl spielt einen Videodetektiv (das gab es damals schon), der im Frankfurter Rotlichtmilieu Recherchen anstellt und dabei sich selbst in den Netzen verfängt, die er auslegt. „Hautnah“ ist einer der besten Fernsehfilme seines Jahrzehnts, wenn nicht überhaupt. Also Peter Schulze-Rohr.
Doch das war nicht einfach. Schulze-Rohr war Macks Chef im Sender, der jedes Jahr einen Film selbst inszenierte. Und jedes Jahr stand ganz oben auf der Liste „Casanova“. Um es kurz zu machen, Peter schaffte es nie, Casanova zu drehen, aber er inszenierte „Notwehr“.
Von Peter Schulze-Rohr habe ich in schier endlosen Buchbesprechungen viel von den unerlässlichen handwerklichen Grundlagen des Drehbuchschreibens gelernt, von der Vermeidung von Teichoskopien bis zum Eindampfen zu feilen jedes einzelnen Dialogsatzes. Nie hat er mich spüren lassen, wie anfängerhaft-naiv-selbstbewusst ich anfangs bestimmt gewesen bin. Im Gegenteil, er hat mir vom ersten Augenblick unserer Zusammenarbeit an mit seiner eleganten, intellektuellen Berliner Schnoddrigkeit, stets das Gefühl gegeben, ernst genommen zu werden und das Drehbuch zu lieben, trotz dessen Mängeln und Problemen.
Abels Debüt im Fernsehen war nach mehreren Fassungen des Buches beschlossene Sache. Ein gut ausgestatteter Einzelfilm sollte entstehen. Keiner ahnte damals, dass Jean Abel es beim ZDF, also praktisch der Konkurrenz, zum Serienhelden bringen würde. Das hätte an der sorgfältigen Vorbereitung des Drehs auch sicher nichts geändert, denn damals was der SDR ein höchst renommierter Sender, der seine Filme in eigenen Studios in Baden-Baden mit ca. 30 Drehtagen selbst auf 35 mm-Material von Kodak produzierte. Längst vergangene Zeiten!
Auch bei den Besetzungsfragen war meine Meinung erwünscht. Ein guter Abel? Gut und überzeugend in seiner Schnoddrigkeit? Ich weiß noch, dass ich mir von Anfang an, als ich noch nicht im Geringsten an den Film dachte, für die Romanfigur Gottfried John als eine Art äußerliches Vorbild genommen hatte. Sein zerknautschtes Gesicht, die kurzen, struppigen Haare, das war für mich Jean Abel. Aber John war nicht frei. Er selbst erinnert sich heute nicht mehr an eine Anfrage, wie er mir kürzlich erzählte, aber manches bleibt ja bei der Agentur hängen – und wer kannte damals im Filmbusiness schon einen Anwalt namens Abel? Was ist mit Ochsenknecht? Uwe Ochsenknecht war die Idee meines Freundes Ulf Hasper, ein Anwaltskollege, der ein eifriger Kino- und Fernsehgucker ist. Ochsenknecht verkörperte Schnodderigkeit und Biss, Intelligenz und Mut, Eigenschaften, die wir uns alle von unseren Film-Abel wünschten. Und er sagte zu. Damals schon ein Star, war er sicher auch mit dafür verantwortlich, dass der Film eine außergewöhnlich hohe Zuschauerquote erzielte.
Die Besetzung der weiblichen Hauptrolle war unerwartet schwierig. Am Ende fiel die Wahl auf Dagmar Cassens, eine Schauspielerin, die noch keine größere Rolle gespielt hatte. Auch das ist ein Beispiel für die Experimentierfreudigkeit von Regie und Redaktion. Dagmar Cassens hat ihre Sache gut gemacht. Weitere große Rollen hat sie später nicht mehr gespielt. Warum weiß ich nicht.
Dass das Casting schließlich sogar meine Familie erfasste, hat weniger mit der Experimentierfreudigkeit des Regisseurs als mit der Tatsache zu tun, dass die für Kinderarbeit zum Glück bei uns eingeführten strengen Restriktionen auch beim Film gelten. In „Notwehr“ gibt es zwei größere Rollen für Mädchen, einmal Gretchen und Claudia die Tochter des Arztes, die von Käthe entführt wird. Ob beim Film die gesetzlichen Regelungen mit minimalen Drehzeiten pro Tag für die meist übermotivierten Kinder jemals eingehalten worden sind oder werden, weiß ich nicht. Jedenfalls wäre Schulze-Rohrs Drehplan völlig aus den Fugen geraten, wenn die Produktion auf Druck der teamfremder Eltern möglicherweise nur vier Stunden am Tag die Kamera hätte laufen lassen dürfen.
So kam meine Tochter Léonie-Claire zu ihrem Filmdebüt als Claudia. Später sollte sie mit mir den bisher letzten Abel-Krimi „Hurenspiel“ schreiben. Als Time Goes By! Die Tochter von damals engen Freunden, Lara Lauk, spielte das bemitleidenswerte Gretchen. Beide haben ihre Sache großartig gemacht. Genauso wie übrigens Personal aus meinem Anwaltsbüro, die in der Stuttgarter Oper Komparserie waren, buchstäblich allen voran meine inzwischen seit fast 25 Jahren für mich arbeitende Sekretärin „Schmittchen“ mit ihrem Mann, die in großer Robe als erste im Bild erscheinen, wenn die Tür zum Zuschauerraum aufgeht und Abel mit Käthe ungeduldig wartet, ob die Richterin kommt.
Und am Ende erwischte er mich selbst noch – als Gatte der Amtsrichterin. Im Film haben wir uns dafür entschieden, aus dem Dr. Kehrmeister eine Frau zu machen, weil es einer Frau noch schwerer fallen würde, ein Urteil über das Leben eines Kindes zu sprechen. Eine Frau wird emotionaler vom Publikum wahrgenommen, als ein Mann. Okay … Schulze-Rohr brauchte einen Ehemann, den die Richterin in der Oper verabschiedet, um sich der heiklen Entscheidung zu stellen. Schulze wolle keinen Komparsen (die sehen alle aus wie Komparsen). Also gab ich den Gatten der Richterin.
Ich witzelte noch herum und sage: hätte ich das geahnt, ich hätte ihm einen Monolog von Shakespearescher Dimension (ich rede hier nur von der Länge) ins Buch geschrieben. Nun hatte ich nur auf den Satz „Nimm ein Taxi“ zu antworten: „Es geht auch mit der Straßenbahn“ (Der Film spielt in Stuttgart!). Bei der Probe war ich perfekt, fühlte mich wie der junge Jack Nicholson. Tja, und dann lief die Kamera – und ich hatte den Satz vergessen. Ich schmiss zwei Klappen. Der Regisseur bewahrte mühsam Ruhe (er hatte mich ja gebeten), ich war tierisch nervös. Zwei Einstellungen klappten, aber ich redete mit einem Stimmchen … Am Schluss haben sie mich in der Postproduktion synchronisiert. So endeten jäh meine (nie ernsthaften) Ambitionen auf die Schauspielerei. Nur einmal noch habe ich in einem Abel-Film einen Heiratsschwindler namens Gerhard Schröder gegeben (als der gleichnamige Politiker noch nicht Kanzler war, wie ich betonen möchte). Die Rolle war stumm. So ist mir dort das Synchronisieren erspart geblieben.
„Notwehr“ wurde am 26.10.1988 um 20:15 Uhr in der ARD gesendet. Mein Gott waren wir alle aufgeregt! Die gesamte Familie und alle Freunde waren alarmiert. Der engere Kreis versammelte sich bei uns zu Hause, um meiner Tochter und mir, den Mitwirkenden am Film, das echte Publikumsgefühl zu geben, was einem normalerweise beim Fernsehen ja fehlt. Alle fieberten mit. Eine solche Premiere ist ja etwas Außergewöhnliches. Kaum war der Abspann gelaufen, klingelte das Telefon – und es stand nicht still bis Mitternacht. Ganz besonders präsent ist mir das Gespräch mit Peter Schulze-Rohr, der in seiner witzigen und ruhigen Art mit zurückhaltender Genugtuung unsere Arbeit lobte und sich bei mir für das Buch bedankte – nur wenige seiner Kollegen haben das nach ihm getan.
Das war der Beginn einer freundschaftlichen Arbeitsbeziehung zwischen Schulze-Rohr und mir, die über insgesamt sechs Filme bis ins Jahr 2000 tragen sollte. Aus ihr sind zwei meiner wichtigsten Fernsehfilme hervorgegangen, der Tatort „Jagfieber“ mit Ulrike Folkerts, Andy Hoppe, Jörg Schüttauf und Anke Sevenich und der Zweiteiler „Der Mann mit der Maske“, in dem Sebastian Koch und Nicolette Krebitz ihre ersten Hauptrollen spielten.
Als „Notwehr“ gesendet wurde, saß ich schon am zweiten Drehbuch mit Jean Abel in der Hauptrolle.
“Der Dienstagmann”, Start der ersten Anwaltsserie im ZDF
Der Dienstagmann“ war ursprünglich der dritte Abel-Roman. Er spielte im Jahr 1983 und kam 1984 bei Rowohlt heraus. Ich habe den „Dienstagmann“, wie einige anderen Abel-Krimis nachdem ich im Unfrieden von Rowohlt geschieden war, gründlich überarbeitet und modernisiert und bei anderen Verlagen, unter anderem Piper, neu herausgegeben. Ursprünglich lebte Abel in Stuttgart, war aber kein Schwabe – genauso wie ich. Durch seine Filmkarriere beim ZDF verschlug es Jean nach München. Nun ist ihm der Buch-Abel gefolgt und vom einigermaßen urbanen Stuttgarter Osten ins wirklich urbane Lehel gezogen, einem Stadtteil zwischen Altstadtring und Isar, wo ich selbst einige glückliche Jahre lebte, bevor ich nach Berlin zog.
Die drei Enden im “Dienstagmann”
„Der Dienstagmann“ ist, wie auch „Notwehr“ kein klassischer Krimi, denn es geht nicht um Mord. Aber andererseits: der Roman schildert die Geschichte einer Ermittlung, so wie es sich für einen guten Krimi gehört. Wenn man es genau nimmt, ist es die Geschichte von zwei Ermittlungen, die des Anwalts und die der Polizei, was sehr typisch für Anwalts-Krimis ist, die in Deutschland leider weder Tradition noch junge Autoren haben. Weiß der Teufel, warum meine deutschen Autorenkollegen einen derartigen Narren an den Kommissaren gefressen haben. Die Obrigkeit, eine heimliche Liebe? Als ungeheure Weiterentwicklung des Genres galt ja lange Jahre die Kommissarin.
Doch zurück zum „Dienstagmann“: Im Zentrum dieses Romans, ebenso wie des Films steht ein schwerer Konflikt unseres Helden Jean Abel. Er, der notorische Kämpfer und Zweifler muss sich Klarheit über die Schuld seines Mandanten verschaffen und manövriert sich in eine Zwickmühle, in der das formale Recht über die Gerechtigkeit einen bitteren Triumph zu erringen droht. Als Abel feststellt, dass sein Mandant Hiltsch völlig zu Recht wegen Vergewaltigung angeklagt wurde, ist es zu spät. Sie Saat seiner engagierten Arbeit geht auf. Hiltsch wird folgerichtig und rechtsstaatlich korrekt freigesprochen.
Nicht nur Abel, auch mich als Autor, der ich ja selbst seit 30 Jahren Anwalt bin, hat dieser Konflikt meines Helden nie in Ruhe gelassen. Was ich wichtiger? Dass das formale und rechtsstaatlich so ungeheuer wichtige Prinzip des Grundrechts eines Angeklagten auf Verschwiegenheit seines Anwalts nicht angetastet wird – selbst um den Preis eines gefährlichen Justizirrtums? Oder muss die Moral siegen und ein gerechtes Ende am Schluss stehen, ein Ende, bei dem das Verbrechen gesühnt wird – Grundrechte hin oder her?
Deswegen gibt es drei unterschiedliche Versionen des Schlusses der Geschichte vom Dienstagmann.
In der ersten Ausgabe bei Rowohlt wird Hiltsch von Holz wegen der Vergewaltigung an Frau Fiedler verhaftet. Abel sieht zu, wie der Polizist, den er hasst, ihm aus der Gewissensnot hilft. Das war sicherlich nicht die beste Lösung – schon aus Gründen der Dramaturgie nicht. Denn der Krimiheld muss die Geschichte selbst zu Ende bringen, nicht einer seiner Gegenspieler. Das macht die Hauptfigur zu klein. Besonders am Schluss ist das fatal. Zur Entschuldigung für diesen Fehler kann ich lediglich anfügen, dass man in den 80er Jahren diese dramaturgisch-formalen Aspekte nicht so wichtig nahm. Der Romanheld durfte (wie der Romanautor) auch Fehler machen oder von äußeren Umständen profitieren, auf die er keinen Einfluss hatte. Erst später wurde „Kommissar Zufall“ – mit Rech, wie ich heute meine – verpönt.
In der hier vorliegenden Neubearbeitung des Romans dagegen habe ich versucht, das Problem à la Abel zu lösen. Er selbst führt das gerechte Ende herbei, indem er lieber den Pakt mit dem Teufel in Gestalt des bigotten Polizisten Holz schließt, als Hiltsch davon kommen zu lassen, auch um den Preis einer von Holz erpressten Aussage von Frau Fiedler. Das widerspricht zwar krass dem rechtsstaatlichen Empfunden – wie das ganze Ende der Geschichte – ist aber im Namen der Gerechtigkeit ganz okay. Wie Abel allerdings seinen Mandanten an Holz im Namen der Gerechtigkeit verrät, lasse ich bewusst im Dunkeln, denn die Schilderung des Deals würde die Schlusspointe vorwegnehmen. Und außerdem ist dieser heimliche Parteiverrat nun mal kein Königsweg für einen guten Anwalt – aber eine Geschichte die das Leben schreiben könnte und damit ein Ergebnis à la Abel, der sich ja immer gerne mal ein bisschen durchwurstelt, damit das Resultat stimmt.
Auch während der Entstehung des Drehbuchs zum Film, wurde Natur gemäß und aus denselben Gründen ebenfalls viel über den Schluss diskutiert. Klar war, dass Abel nicht von Holz Hilfe abhängig sein durfte. Nach langem Hin und Her wählte ich hier den radikalsten Schluss: Die bittere Saat von Abels Bemühungen geht auf. Hiltsch wird freigesprochen. Abel muss mit der Hypothek seiner moralischen Niederlage leben. Und Hiltsch wird eine ständige Bedrohung für die Integrität und das Leben von Frauen sein. Regisseur Frank Guthke fand in seiner Schlusseinstellung dafür eine klare Metapher : Wir sehen wie der großartige Dieter Pfaff, der den Hiltsch spielt, das Justizgebäude verlässt und in die Menschenmenge auf dem sommerlichen Stachus eintaucht, bis wir ihn nicht mehr erkennen. Obwohl der Film mit einer deftigen Niederlage der Gerechtigkeit endet, war er der Auftakt für ein Reihe von insgesamt 20 Abel-Filmen, die das ZDF zwischen 1988 und 2001 sendete.
Wie Abel zum Serienhelden wurde
Heute werden Serien und Reihen im Fernsehen minutiös geplant. Man versucht das jedenfalls. Denn das Publikum ist launisch und wechselt Geschmack und Vorlieben. Ich wage nicht zu beurteilen, ob Abel heute eine Chance hätte. Die Abel-Reihe dagegen entwickelte sich organisch aus dem ersten Film, und ihre Fortsetzung hing oft am seidenen Faden der Quoten.
In den 80er Jahren war die Spontaneität und die Entscheidungsfreude der Programmverantwortlichen größer – und ihre Spielräume weiter. Die Folge war ein aus heutiger Sicht fast ans Unvorstellbare grenzende Risikofreude. So entstanden Hits wie der „Tatort“ an sich, „Schimanski“, „Kir Royal“ in der ARD, „Der Alte“ und „Derrick“ im ZDF – und nicht zu vergessen der unvergleichliche „Liebling Kreuzberg“ von Jurek Becker mit Manne Krug in der Hauptrolle, mein Vorbild schlechthin für eine Anwaltsserie.
Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich nicht von einer Abel-Serie im Fernsehen geträumt hätte, nachdem die ersten Anfragen von Sendern für Romanverfilmungen kamen. Aber die Sendeplätze für Reihen waren rar. Zu dieser Zeit kämpfte beispielsweise mein Freund Huby noch vergeblich um eine Serie mit seinem Kommissar Bienzle als Hauptfigur.
Allerdings machten mir die Verfilmungen meiner Krimis Mut. „Notwehr“ war im damaligen Südwestfunk unter der Leitung von Dietrich Mack und Susan Schulte entstanden. Und Susan war auch für die dritte Abel-Verfilmung verantwortlich: „Frohes Fest, Lucie“, dem ersten Film, denn Roland Suso Richter drehte. Doch davon später, wenn dieser Roman erscheint. Nur so viel: Abel hatte insgesamt drei Interpreten, einer renommierter als der andere: Uwe Ochsenknecht in „Notwehr“, in „Frohes Fest, Lucie“ Thomas Heinze – und Günter Maria Halmer im „Dienstagmann“.
Halmer wurde von Frank Guthke besetzt. Er war bis dato als „Tscharlie“ aus den „Münchner Geschichten“ bekannt und international als Schauspieler fast mehr gesucht als in Deutschland. Das ist keine Seltenheit. Nicht nur der Prophet gilt im eigenen Lande manchmal nicht so viel. Halmer spielte beispielsweise 1982 den Auschwitz-Kommandanten Rudolf Hoess in „Sophie’s Choice“ und Dr. Herman Kallenbach in „Ghandi“ an der Seite von Ben Kinsgsley.
Günter Maria Halmer prägte wie kein anderer den Jean Abel, gab ihm über 20 Folgen von je 90 Minuten Gesicht und Charakter – und zwar dermaßen, dass ihn Leute in der Stadt mit „Herr Rechtsanwalt“ ansprachen und um den einen oder anderen Tipp in Rechtsangelegenheiten baten – und natürlich auch um Autogramme. Halmer verkörperte von der ersten Minute an für mich den typischen Münchner Flaneur und Bonviant, aber zugleich auch den Anwalt, der beißen konnte wie Salzsäure, wenn es um Wahrheit, Gerechtigkeit und seine Mandanten ging. Günter gehen die schwierigsten Dialoge, gespickt mit juristischen Fachwörtern ebenso leicht und elegant von den Lippen wie ein Flirt mit seiner Babyjane. Die Zuschauer sehen in ihm gleichermaßen den Intellektuellen, den Genießer und den Träumer. Einfach ideal!
Keiner der Abel-Filme spielt dort, wo ich ursprünglich die Romane und damit meine Hauptfigur angesiedelt habe: in Stuttgart. Denn Stuttgart verfügte damals über keine nennenswerte Filminfrastruktur. Die Studios des damaligen „Südwestrundfunks“ waren längst zerschlagen und ersatzlos aufgelöst worden. So musst Abel für die Filme auswandern – beim Südwestfunk nach Baden, für das ZDF nach München. München war und ist Filmstadt Nummer eins in Deutschland. Und München war damals nicht nur die so genannte heimliche Hauptstadt Deutschlands, sie war auch die Krimihauptstadt. Beste Voraussetzungen also für eine Serie. – Doch so weit war es noch lange nicht..
Geplant war mit dem „Dienstagmann“ eine Literaturverfilmung, also ein Einzelstück, weil der Roman dem damaligen Redakteur gut gefiel. Regie führte Frank Guthke, einer der damals beim ZDF fest angestellten Regisseure. Er hatte in Hollywood lange als „First AD“ (Erster Regieassistent) gearbeitet und brachte eine enorme Spielfilmerfahrung und eine „amerikanische“ Erzählweise mit. Guthke erwies sich als ein Meister des Castings und der Schauspielerführung. Er besetzte besonders gerne „gegen den Strich“. Mir wäre beispielsweise nie in den Sinn gekommen, Dieter Pfaff, damals der Inbegriff des gemütlichen Gutmenschen, in der Rolle des Sigurd Hiltsch zu sehen. Und es funktionierte wunderbar!
Die Drehbucharbeit war für mich sehr schwierig und voller Umwege. Die erste Fassung, die sich noch sehr nah an der Romanvorlage hielt, war über 400 Seiten stark. Das hätte locker für vier Filme ausgereicht. Ich traute mich nicht, den Text bei der Redaktion einzureichen und fing an zu kürzen. „Kill your babies“ … eine schwierige Sache. Es war ein langes zähes Ringen mit mir selbst, das Buch auf die Sendelänge zu kürzen.
Als schließlich der Film im Kasten war und am Vorabend meines 42. Geburtstages gesendet wurde, war der Erfolg beim Publikum überwältigend. 8,8 Millionen Zuschauer für einen Fernsehfilm … eine Quote, von der man heute angesichts der großen Konkurrenz auf allen Kanälen nur noch träumen kann.
Auch die Presse spendete weitgehend Lob, aber es gab auch kritische Stimmen. Nebenbei: ich habe es noch nie erlebt, dass einer meiner Filme ein ungeteiltes Presseecho gefunden hätte. Und das ist eigentlich gut so. Denn wer es allen Recht macht, macht irgendetwas nicht richtig. Deswegen habe ich mir angewöhnt, auf meiner Homepage zu jedem Film zwei Zitate aus der Presse zu bringen: Die gute und die schlechte Kritik.
Beim Dienstagmann las sich das so:
Die gute Kritik: „In den spannendsten Momenten herrscht hier nicht betriebsame Hektik mit hysterischen Ausbrüchen, sondern einfühlsame Ruhe, die das Maß; der Spannung ins fast unerträglich steigert. (Süddeutsche Zeitung)
Die schlechte Kritik: „Haarsträubende Geschichte!“ (Badische Neueste Nachrichten)
Kurz und gut, der Film wurde auch beim Sender geschätzt. Heinz Ungureith, der damalige Leitende Redakteur beim ZDF für Film und Serien fragte kurz darauf bei der Redaktion an, ob der Autor noch andere Krimis zum Verfilmen habe.
Er hatte.
Und als Weihnachtsgeschenk 1988 bekam ich den Auftrag für die nächsten Abel-Krimis im ZDF: „Reiche Kunden killt man nicht“ und „Noch Zweifel, Herr Verteidiger“. Es sollte insgesamt noch 17 Filme folgen, bis die Serie 2001 mit dem Film „Salut Abel“ endete.
Alle 20 ZDF-Filme wurden von der in München ansässigen Produktionsfirma „TV60film“ realisiert. Bernd Burgemeister, der Produzent erhielt unter großem Beifall für diese Leistung den Deutschen Fernsehpreis. Ich wurde für den Adolph Grimme Preis in der Kategorie „Spezial“ für meine Abel-Drehbücher nominiert. Verschiedene Episoden wurden auf nationalen und internationalen Filmfestivals gezeigt
Frank Guthke inszenierte die ersten sieben der 20 Abel-Filme. Zu den meisten komponierte Wolfgang Dauner die Musik, intensive, jazzige Stücke vom Großmeister des deutschen Jazzpianos auch zusammen mit einer Combo selbst eingespielt. Guthke folgten als Regisseure Carlo Rola, Josef Rödl, Olaf Kreinsen, Martin Weinhart, Marc Rothemund und Christian Görlitz.
In Gastrollen neben Günter Maria Halmer waren u.a. Iris Berben, Suzanne von Borsody, Karoline Eichhorn, Sophie von Kessel, Cornelia Froboes und Susanne Lothar zu sehen sowie Bruno Ganz, Ivan Desny, Birol Unel, Friedrich von Thun, Henry Hübchen, Matthias Habich, Helmut Griem, Ernst Jacobi, Gerhard Voß und Peter Sattmann, um nur einige zu nennen.
Babyjane, die Frau an Abels Seite, spielte die charmante Andrea l’Arronge genauso gescheit und umsichtig, so sexy und kompetent, wie es sich der Autor nur träumen konnte.
